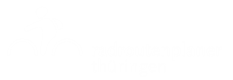Für den Radroutenplaner Thüringen sind von den Tourismusagenturen Informationen zusammengestellt worden.
Diese werden mit unterschiedlichen Symbolen auf der Karte dargestellt. Mit einem Klick auf das Symbol erhalten
Sie Informationen und Bilder.
Sie können sich auch mit Hilfe der nachfolgenden Auswahl direkt über jede Sehenswürdigkeit informieren und dann per
Mausklick den zugehörigen Kartenausschnitt öffnen.